Eine amputierte soziale Marktwirtschaft kann auf einem Bein nicht stehen
von Dominika Biegon, Maximilian Held und Alexander Schellinger
Die sozialen Marktwirtschaften der Nachkriegszeit sind alle Mischökonomien, also Kombinationen aus Staat und Markt. So kann – oder konnte – der deutsche Bundesstaat ein sozialer sein, weil er durch Regulierung Marktgeschehen beeinflusst, und durch Steuern Marktergebnisse umverteilt. Natürlich gibt es effizientere oder teurere, gerechtere oder willkürlichere, größere oder kleinere solcher Markteingriffe: Diese schwierigen Abwägungen hat der demokratische Souverän zu treffen, vertreten durch seine Repräsentanten. Begrenzt nur durch Rechtsstaatlichkeit, Freiheits- und Eigentumsrechte bleibt einer demokratisch regierten Mischwirtschaft aber ein erheblicher Spielraum, ihre konstituierenden Komponenten Markt und Staat auszubalancieren. Trotz aller vermeidbaren Defekte und unvermeidlichen Kosten der real existierenden Mischwirtschaften seit 1945: verglichen mit den real gewordenen Alternativen – den unfreiheitlichen wie verschwenderischen Planwirtschaften und den ungleichen wie instabilen reinen Marktwirtschaften – sind sie ein historischer Glücksfall. Als soziale Marktwirtschaften vereinen sie das Beste beider Welten: Effizientes Wirtschaften, ökonomische wie politische Freiheitsrechte, staatlich bereitgestellte Gemeingüter, und demokratisch legitimierte Umverteilung.
![]() Der gegenwärtige Modus der europäischen Einigung – wie wirtschaftlichen Öffnung insgesamt – beschneidet die Mischökonomien empfindlich in ihren Fähigkeiten in Märkte einzugreifen. Damit staatlicher Eingriff und offener Handel effizient ko-existieren können, müssen beide auf gleicher Ebene organisiert werden. Wenn sich Marktaktivitäten – etwa Kapitalmärkte – auf europäischer, oder sogar weltweiter Ebene organisieren, sind die weiterhin national organisierten Staaten ihrer zentralen Instrumente, der Steuer und der Regulierung, beraubt. Jeder Eingriff in diese höher organisierten Märkte, insbesondere progressive Umverteilung, zieht eine unerwünschte Verlagerung dieser Aktivitäten in weniger regulierte oder besteuerte Staaten nach sich. Im Wettbewerb um wohlstandsgenerierende Marktaktivitäten reduzieren die Nationalstaaten im Extremfall ihre Markteingriffe, oder sind mindestens nicht mehr in der Lage beliebige Eingriffe vorzunehmen. Sowohl die Verlagerungen von wirtschaftlicher Aktivität, oder, alternativ, reduzierte Markteingriffe sind ineffizient für die Volkswirtschaft. Die Verlagerung ohne reale Wettbewerbsvorteile führt zu wirtschaftlichen Ungleichgewichten, Arbeitslosigkeit und anderen Überkapazitäten. Alternativ streicht der dann pleite und impotente Staat eigentlich effiziente Regelungen, wertvolle öffentliche Güter oder nimmt – äquivalent – übermäßige Schulden auf, druckt zu viel Geld oder erlaubt phantastische Kredit- und Vermögensblasen. Zusätzlich sind diese gelähmten Mischwirtschaften nicht mehr in der Lage progressive Umverteilung zu organisieren – sollten ihre Bürgerinnen das wollen.
Der gegenwärtige Modus der europäischen Einigung – wie wirtschaftlichen Öffnung insgesamt – beschneidet die Mischökonomien empfindlich in ihren Fähigkeiten in Märkte einzugreifen. Damit staatlicher Eingriff und offener Handel effizient ko-existieren können, müssen beide auf gleicher Ebene organisiert werden. Wenn sich Marktaktivitäten – etwa Kapitalmärkte – auf europäischer, oder sogar weltweiter Ebene organisieren, sind die weiterhin national organisierten Staaten ihrer zentralen Instrumente, der Steuer und der Regulierung, beraubt. Jeder Eingriff in diese höher organisierten Märkte, insbesondere progressive Umverteilung, zieht eine unerwünschte Verlagerung dieser Aktivitäten in weniger regulierte oder besteuerte Staaten nach sich. Im Wettbewerb um wohlstandsgenerierende Marktaktivitäten reduzieren die Nationalstaaten im Extremfall ihre Markteingriffe, oder sind mindestens nicht mehr in der Lage beliebige Eingriffe vorzunehmen. Sowohl die Verlagerungen von wirtschaftlicher Aktivität, oder, alternativ, reduzierte Markteingriffe sind ineffizient für die Volkswirtschaft. Die Verlagerung ohne reale Wettbewerbsvorteile führt zu wirtschaftlichen Ungleichgewichten, Arbeitslosigkeit und anderen Überkapazitäten. Alternativ streicht der dann pleite und impotente Staat eigentlich effiziente Regelungen, wertvolle öffentliche Güter oder nimmt – äquivalent – übermäßige Schulden auf, druckt zu viel Geld oder erlaubt phantastische Kredit- und Vermögensblasen. Zusätzlich sind diese gelähmten Mischwirtschaften nicht mehr in der Lage progressive Umverteilung zu organisieren – sollten ihre Bürgerinnen das wollen.
Drei Ergänzungen zu diesem Schreckensszenario sind wichtig: Erstens ist die Öffnung von Grenzen, und die Liberalisierung von Märkten – wenn und in dem Maße diese Märkte einigermaßen effizient funktionieren – immer ein Wohlstandsgewinn. Wirtschaftliche Einigung ist die Lösung, nicht das Problem. Zweitens müssen nicht alle staatlichen Eingriffe auf höchster, europäischer Ebene organisiert werden, sondern nur solche, die ebenfalls europäisches Wirtschaftsgeschehen betreffen. Europaweit oder weltweit gehandelter Stahl und Staatsschulden müssen in Brüssel (EU) oder Washington (IWF) organisiert werden, regional genossener Käse oder naheliegende Friseure können und sollten weiterhin in Berlin, Bremen, oder sogar im Ortsamt Mitte-Östliche Vorstadt reguliert werden. Drittens sind dem folgend auch gegenwärtig keinesfalls alle staatlichen Eingriffe von Wettbewerb gefährdet, sondern nur einige, wenn auch wichtige. So fällt es den wirtschaftlich offenen Staaten zunehmend schwerer, große Kapitaleinkommen zu besteuern und zu regulieren. Die kleineren, oft weniger mobilen Arbeitseinkommen sind aber noch weitgehend besteuert und reguliert.
Es lässt sich nicht sicher zeigen, dass die westlichen Sozialstaaten bereits tatsächlich ihre Eingriffe und Verteilungsziele reduziert haben, erst Recht nicht wegen der europäischen Einigung. Deutlich ist aber, dass der gegenwärtige Modus europäischer Einigung nichts tut, um die staatliche Lenkbarkeit der teilnehmenden Marktwirtschaften wieder herzustellen. Diese europäischen sozialen Marktwirtschaften stehen auf nur einem Bein: Dem des vervollständigten, gemeinsamen Marktes. Das andere Bein ist auf europäischer Ebene nur verkrüppelt ausgebildet (als minimale Strukturfonds), und auf nationaler Ebene zunehmend atrophiert.
Zwar sind einige Ursachen der gegenwärtigen Krisen hausgemacht – Mischwirtschaft und Misswirtschaft liegen leider, wie das Beispiel Griechenlands zeigt, nicht nur orthographisch nahe beieinander – aber es kann insgesamt niemanden überraschen, dass Europa und seine Mitgliedsstaaten, alle auf einem Bein durch schwierige wirtschaftliche Transformation hüpfend, ins Straucheln geraten. Wo in einer intakten sozialen Marktwirtschaft der Staat schwächelnde Regionen durch Transfers stützen kann, oder durch autonome Geldpolitik wettbewerbsfähig machen kann, gibt es im gegenwärtigen Europa nur eine Geldpolitik und keine nennenswerten Transfers. Da es im Euroraum nur eine Geldpolitik gibt, können die wettbewerbsschwachen Länder nicht einfach oder schnell ihre Exporte günstiger, und Importe teurer machen, sondern müssen auf die oft langsame Anpassung von Lohnkosten warten. Die Alternative – regionale Subventionen, wie etwa im deutschen Länderfinanzausgleich – steht in der EU mit ihren vernachlässigbaren Transfers ebenfalls nicht zur Verfügung. Wo in einer intakten sozialen Marktwirtschaft der Staat seine demokratisch gewünschten Ausgaben – durch entsprechende Steueraufkommen decken kann, bleibt ihm im europäischen Steuerwettbewerb nur die Flucht in Schulden (wie in Griechenland), oder – ebenso „auf Pump“ – zugelassene Kredit- und Vermögensblasen (wie in Spanien). Wo in einer intakten sozialen Marktwirtschaft der demokratische Souverän (fast) frei über Verteilungsziele und Staatsquoten entscheiden kann, bleiben den europäischen Wählerinnen nur die gleichermaßen unattraktiven Alternativen des wohlstandsvernichtenden Austritts, oder sozialfeindlicher Mitgliedschaft, neuerdings ergänzt durch regelmäßig erpresste Transferzahlungen (verklausuliert im ESM) unter Geiselnahme des gesamtem Projektes (Zerfall des Währungsunion).

In der intakten sozialen Marktwirtschaft folgt mehr wirtschaftlicher Integration immer mehr politische Integration, und kann mehr Handel immer mehr Solidarität folgen: Der Sozialvertrag bleibt lebendig, intakt und wandlungsfähig. Die gegenwärtig ausschließlich wirtschaftliche Integration in der EU – neuerdings zusätzlich einer gemeinsamen Schuldenbremse, aber immer noch keiner Fiskalunion – verlässt diese Korrespondenz von Markt und Staat, und wird zwangsläufig beide Bezugspunkte verletzen: effizientes Wachstum und demokratisch legitimierte Verteilungsziele.
Das gefährdet den historischen Glücksfall von Frieden, Wohlstand und Teilhabe in Westeuropa (wie anderswo) seit 1945. Wie John Maynard Keynes 1919 im Hinblick auf den Versailler Vertrag, und später, die Katastrophe der Weimarer Republik vorwegnehmend, warnte: „Aber wer kann schon sagen, wie viel zu ertragen ist, oder wohin sich die Menschen wenden werden, um ihrem Unglück zu entkommen?“
Sozialdemokratischer Spielraum: Ein gemeinsamer Wirtschafts- und Sozialraum
Wir brauchen kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die aus der Krise führen, und einen langfristigen Fahrplan, der nicht nur einem ökonomischen Imperativ folgt, sondern das Primat der Politik über das des Marktes wieder herstellt. Zur effektiven Bekämpfung der Krise in der Eurozone müssen zunächst die unmittelbaren Auslöser in Angriff genommen werden. Wie vorausgehend dargestellt, hat die einheitliche Geldpolitik im Euroraum bei dezentraler Fiskalpolitik die gegenwärtige Krise wesentlich verstärkt. Eine stärker koordinierte Fiskalpolitik innerhalb des Euroraums ist also ein erster Schritt zur Bekämpfung der Krise.
Die aktuelle Strategie hat jedoch zwei grundlegende Probleme. Das erste Problem besteht darin, dass in der Bundesregierung „koordinierte Fiskalpolitik“ synonym für „Haushaltsdisziplin“ steht; das Allheilmittel heisst: „nationale Schuldenbremse“ . Dagegen haben viele Experten aufgeschrien. In der Tat spricht aus historischer Perspektive Einiges dafür, dass eine krasse Ausgabenkürzung in Zeiten großer Unsicherheit Wirtschaftskrisen extrem verschärft. Mittlerweile hat selbst die Führung in Berlin das Kamikaze-Potential ihrer Strategie zumindest de facto anerkannt indem sie die EZB bei ihrem unbegrenzten Anleihenkauf gewähren lässt. Das Drucken von Geld – darin sind sich alle einig – kann aus wirtschaftlicher Sicht auf die Dauer keine Lösung sein. Mindestens genauso problematisch ist jedoch, dass nun demokratisch gewählte Regierungen am Tropf Frankfurter Technokraten hängen. Die Schuldenbremse muss also von einer koordinierten Ausgabenpolitik begleitet werden.
Damit die Eurozone die Krise bewältigen kann bedarf es eines Wachstumsprogramms großen Stils – eine Umverteilung unabgefragter EU-Fördermittel sind dagegen Peanuts. Eine nachhaltige EU-Industriepolitik könnte die notwendige Korrektur zugunsten des produzierenden Gewerbes im Euroraum weiter vorantreiben. Das bedeutet mittelfristig einen größeren Haushalt für die EU. Große Beträge nimmt gegenwärtig jedoch nur die EZB in die Hand. Kein Wunder, für die politisch Verantwortlichen ist das die einfachste Lösung: Man lässt die EZB Geld drucken während man sich selbst eine Nadel für schwäbische Sparsamkeit an die Brust heftet.
Langfristig wird eine koordinierte Fiskalpolitik in diesem Stil aber nicht reichen: Mit nationalen Instrumenten – Stichwort: Schuldenbremse – sollen europäische Ziele erreicht werden. Dieser Plan funktioniert nicht, denn nationale Politik muss auf nationale Interessen reagieren. Das zeigt die jüngste Vergangenheit: Im Prinzip ist der gegenwärtige Fiskalpakt dem Stabilitätspakt von 1997 sehr ähnlich. Beide Verträge versuchen die Haushaltspolitik der Mitgliedsstaaten stärker zu kontrollieren. Wenn Politiker heute so tun als sei der Bruch des Stabilitätspaktes durch Deutschland und Frankreich beginnend im Jahr 2003 ein bloßer Fehltritt gewesen, vergessen sie die politischen Realitäten, die sie dazu gezwungen haben; an diesen hat sich aufgrund der Verhaftung der politischen Debatte im nationalen Kontext jedoch reichlich wenig geändert. Die Anreize zum Vertragsbruch sind somit institutionell angelegt.
Auf die Dauer muss die Fiskalunion die Ausgaben- und Einnahmenseite auf europäischer Ebene organisieren. Dies ermöglicht eine effektive Kontrolle der Ausgaben basierend auf gemeinsamen Einnahmen. Dafür ist die Harmonisierung von Steuern ein wichtiger Schritt. Eine Transferunion müsste diese europäischen Steuern flankieren, damit bei hohem Steuerniveau die ärmeren Mitgliedsstaaten wettbewerbsfähig bleiben können: Solidarität (Umverteilung) und Wachstum (Effizienz) bedingen einander. Auch eine stärkere Koordinierung der europäischen Lohnpolitik ist als Ergänzung der gemeinsamen Geldpolitik und koordinierten Fiskalpolitik notwendig. Nur so kann vermieden werden, dass einzelne Mitgliedsstaaten auf Kosten der Nachbarn an Wettbewerbsfähigkeit durch immer weitere Senkung der Löhne gewinnen können und somit neben Wirtschaftsgütern auch ihre Arbeitslosigkeit exportieren. Eine koordinierte Lohnpolitik ist deshalb genauso wesentlich für den Abbau wirtschaftlicher Ungleichgewichte wie eine koordinierte Fiskalpolitik. Dieser nächste Schritt in der europäischen Integration würde aber nicht nur einer zweiten Eurokrise vorbeugen, sondern würde auch die langbestehende Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und sozialer Integration endlich auswetzen.
Um die eingangs analysierte Schwächung des nationalen Wohlfahrtstaates und der industriellen Beziehungen durch den europäischen Binnenmarkt Einhalt zu gebieten, bedarf es einer stärkeren sozialen Dimension des europäischen Projektes. Während die europäische Gesetzgebung hinsichtlich des gemeinsamen Binnenmarktes in immer neue Domänen vordringt, blieben soziale Ziele vollkommen unverbindlich im Rahmen der sogenannten “Methode der offenen Koordinierung”. Diese koordiniert lediglich die nationalen Sozial- und Arbeitspolitiken, schafft aber keine rechtlichen Grundlagen. Dabei besteht gerade aufgrund der fortschreitenden wirtschaftlichen Integration höchster Handlungsbedarf. Eine europäische Basisarbeitslosenversicherung, ein effektiver Arbeitsschutz und europäische Mindeststandards könnten ein längst überfälliger Anfang sein.
Die Vision einer politischen Union
Eine europäische politische Union ist zum einen aus wirtschaftspolitischer Sicht geboten, denn nur durch eine institutionelle Absicherung einer gemeinsamen Fiskal-, Wirtschafts-, und Sozialpolitik kann die Politik gegenüber dem Markt auf europäischer Ebene Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Eine Vertiefung der Integration ist aber auch aus demokratietheoretischer Perspektive vonnöten. Problematisch ist, dass die bisherige Strategie der Krisenbewältigung weitestgehend auf intergouvernementalem Weg – d.h. zwischen nationalen Regierungen – erfolgte, weshalb Habermas eine vertragswidrige Entwicklung hin zum „postdemokratischen Exekutivföderalismus“ konstatiert. Diese Form der Krisenlösung birgt Legitimationsprobleme, weil die Bürger bzw. ihre Repräsentanten im Europäischen Parlament kaum am Entscheidungsfindungsprozess beteiligt werden. Damit Europa nicht zu einer Domäne der nationalen Exekutiven wird, müssen weitere Schritte hin zu einer politischen Union erfolgen.
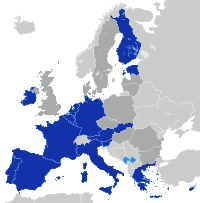
Der Kern der Vision einer politischen Union besteht dabei in einer durchgreifenden europäischen Parlamentarisierung und einer Souveränitätsübertragung auf europäische Institutionen. In einer politischen Union müsste auf allen Politikfeldern zwischen Rat und Parlament ein Gleichgewicht der Kompetenzen hergestellt werden. Dazu sind eine Vertragsänderung sowie die Einberufung eines Verfassungskonvents notwendig. Nur so kann eine politischen Vergemeinschaftung durch die Hintertür und damit die Gefahr, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas nicht ausreichend zu Wort kommen, verhindert werden. Der Prozess der Umverteilung muss ein politischer Prozess sein. Nur so kann es gelingen für ein gerechtes System einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu erlangen. Die EU ist jedoch gerade dabei diesen aufzulösen indem politische Akteure Entscheidungen an vermeintlich unpolitische Institutionen wie die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank oder den Europäischen Gerichtshof übertragen. Gegebenenfalls könnten die Weichen für eine politische Union zunächst im Kerneuropa in den 17 EWU-Mitgliedstaaten gestellt werden.
Der Weg zu einer politischen Union ist allerdings nicht nur über den Weg langwieriger Vertragsänderungen zu beschreiten. Den Blick lediglich auf umfassende institutionelle Reformen zu verengen, birgt die Gefahr, dass dadurch unmittelbar notwendige kleine Schritte in Richtung einer politischen Union verhindert werden und spielt jenen in die Hände, die eine Integrationsvertiefung ablehnen. Werden die Maßstäbe für eine zukünftige politische Union zu hoch gesetzt, könnten weitere Integrationsschritte torpediert werden, da einzelne Länder Vertragsänderungen blockieren können. Deshalb ist Martin Schulz, dem Präsidenten des Europäischen Parlaments (EP) zuzustimmen, der in seiner diesjährigen Humboldtrede hervorhebt, dass wir vorerst auch ohne einen neuen europäischen Vertrag einen „Neustart der europäischen Demokratie“ beginnen können. Kleine Schritte in Richtung einer politischen Union könnten beispielsweise durch eine stärkere Verantwortlichkeit der Kommission gegenüber dem EP, einer „Politisierung“ der EU sowie in Foren der europäischen Zivilgesellschaft und durch eine Europäisierung nationaler Parteien erfolgen. Ebenso könnten Bildungskampagnen und Maßnahmen zur Stärkung eines europäischen Solidaritätsgefühls, etwa durch die Einführung eines freiwilligen europäischen Jahres, eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer politischen Union spielen.
Auch wenn die europäische Integration zu Recht auf viele in der europäischen Linken wie eine Bedrohung wirkt, bietet sie auch eine einmalige Chance die Sozialdemokratie mit neuem Leben für das 21. Jahrhundert zu füllen. Dafür lohnt es sich einzutreten!
